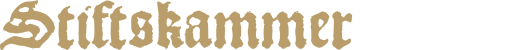Digitale Stiftskammer
| Begriff | Definition |
|---|---|
| Michael Büren II |  Michael Büren II. stammte aus einer münsterschen Familie, die bereits seit mindestens zwei Generationen Goldschmiede hervorbrachte. Im Jahr 1660 ging er bei dem Goldschmied Elias Kemnitz in die Lehre. Sechs Jahre später hatte er diese beendet und wiederum einige Jahre später seinen Meister abgeschlossen. Den Quellen nach ist Michael Büren II. 1707 verstorben. Sein Goldschmiedezeichen: Ein steigender Löwe mit seinen Initalien "MB" darunter |
| Lunula | |
| Lucas Boemer | Der Goldschmied wird in Rheine geboren und lernt ab 1669 bei Johann Boemer in Münster das Handwerk. 1683 erlangt er dort den Meistertitel. Ein Versehkreuz mit Darstellung des heiligen Dionysius, heute im Museum Kloster Bentlage bei Rheine, datiert in sein erstes Meisterjahr.
|
| Lateinische Kirche | Die lateinische Kirche ist Teil der römisch-katholischen Kirche und wird auch Westkirche genannt. Der Name bezieht sich auf die traditionelle Kirchensprache Latein, die bis in die 1960er Jahre Hauptbestandteil der Gebete und Gesänge in den Gottesdiensten war. |
| Kuppa | Als Kuppa wird die obere tiefe Schale eines Kelches bezeichnet, die die Flüssigkeit aufnimmt. |
| Kupferstich | Der Kupferstich gehört zu den grafischen Techniken. In eine gesäuberte und polierte Kupferplatte werden mit einem Grabstichel die feinen Linien einer Zeichnung eingeschnitten. Danach wird die Platte erwärmt und mit Farbe bestrichen. Die Farbe setzt sich aufgrund der Wärme in die geschnittenen Linien ab, während die restliche Platte wieder poliert wird. Mit einer Walze wird die Kupferplatte nun auf ein angefeuchtetes Stück Papier gepresst: Die Linien erscheinen schwarz und die in der Platte stehen gebliebenen Partien bleiben weiß. |
| Kreuzgang | Ein Kreuzgang ist ein Bauwerk innerhalb eines Klosters oder Stiftes. Kennzeichnend ist seine rechteckige Form, die in ihrer Mitte einen offenen Innenhof umschließt. Die vier Gänge sind hingegen überdacht. Eine Seite des Kreuzgangs befindet sich direkt an der dazugehörigen Kirche. An die anderen Gänge schließen weitere Gebäude eines Klosters an, beispielsweise der Speisesaal oder die Schlafzellen. |
| Kapitell | Ein Kapitell ist der obere Abschluss einer Säule oder eines Pfeilers. Je nach Bauzeit konnten Kapitelle ganz unterschiedliche Formen oder Motive zeigen. |
| Kanonissin | Eine Kanonissin ist eine Dame, die in einem Stift lebt. Im Gegensatz zu einer Äbtissin muss sie kein Ordensgelübde abgelegt haben. Häufig entstammten sie adligen Familien, die mit einer hohen Geldsumme den Unterhalt der weiblichen Familienmitglieder im Stift bezahlten. |
| Inschrift der Türzieher | Die Inschrift auf beiden Türziehern erschließt sich nur, wenn sie als Einheit betrachtet werden. Lateinische Fassung: JXPC REX REGNUM FACIAT HAS JANUAS GENTEM CAUSA PRECI(BU)S INGREDIENTEM CONSCENDERE CAELUM BERNHARDUS ME FECIT. |
| Inschrift auf dem Untergewand | Die Inschrift lautet im Original: DIVo bonIfaCIo teMpLI hVIVs / patrono statVa praesens posIta est / eX pIo ferVore / rmae ac perillustris Dnae A. C. a nehem / ex sundermuhlen Canonessa In freckenhorst. Übersetzt werden kann sie wie folgt: „Dem heiligen Bonifatius, Schutzpatron dieser Kirche, ist diese Statue gestiftet worden aufgrund frommer Leidenschaft der hochwürdigsten und hochangesehenen Herrin A.C. von Nehem von Sundermühlen, Stiftsdame in Freckenhorst.“ |
| im Anhänger | Lange Zeit vermuteten die Forscher, dass der silberne, mit Samt ausgekleidete Anhänger älter als die Reliquienbüste sei. Neuere Erkenntnisse gehen jedoch davon aus, dass der Anhänger um 1700/1720 entstanden ist und damit erst nach der Reliquienbüste. |
| Hostie | Die Hostie ist ein dünnes Brot bestehend aus Wasser und Weizenmehl, ähnlich einer Oblate. Sie wird während des Gottesdienstes beim Abendmahl gereicht, gemeinsam mit einem Glas Wein. Nach christlichem Glauben finden sich in Brot und Wein der Körper und das Blut Jesu Christi wieder. |
| Hl. Simeon | Der Hl. Simeon findet Erwähnung im Lukas-Evangelium. Dort ist er bei der Darstellung des kleinen Jesus im Tempel anwesend. Dabei handelt es sich um die christliche Tradition, das erstgeborene Kind Gott darzubringen. Bei diesem Ritual erkennt Simeon im Christuskind den angekündigten Messias. Daraufhin nimmt das Christuskind auf die Arme und preist ihn mit seinem Lobgesang. |
| Hedwig Christina Gertrud von Korff zu Sutthausen | Die spätere Äbtissin (1688-1721) ist um das Jahr 1640 geboren und stammt aus der Familie Korff, die zum Haus Harkotten, heutiges Sassenberg, gehören. Sie war die erste Äbtissin niederen westfälischen Adels. Im Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen erhielt sie die Auflage, ausschließlich in Freckenhorst zu residieren. Ihr Name ist uns aus den Urkunden nicht nur im Zusammenhang mit der großen Stiftung bekannt, sondern auch dadurch, dass sie die Petrikapelle, unsere heutige Stiftskammer, renovieren ließ. |