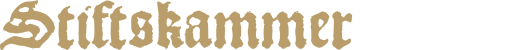Das nun vor Ihnen stehende Objekt erinnert in seiner Form an einen Kelch: Es besitzt einen Standfuß, einen Knauf in der Mitte des Schaftes und eine bauchige Öffnung. Von einem Kelch unterscheidet es sich jedoch durch seine Größe und durch einen Deckel, der auf der Kuppa aufliegt. Der Deckel ist ein Merkmal des Speisekelches, im lateinischen Ziborium (Trinkbecher) genannt.
Das Ziborium ist üppig verziert. In den Standfuß und den Deckel sind Pflanzenranken eingraviert. Auf der Kuppa können Sie diese Pflanzenranken ebenfalls entdecken, jedoch sind sie hier in Silber ausgeführt und noch zusätzlich über das Gold des Speisekelches gelegt worden. Das und die geschwungene Form des Standfußes sowie des Knaufs sind Elemente einer barocken Formensprache.
Entstanden ist das Ziborium im Jahr 1695 als Teil der großen Silberstiftung der Äbtissin Hedwig Christina Gertrud von Korff zu Sutthausen. Interessanterweise wurde dieser Speisekelch nicht von Bartolomäus Kernitz geschmiedet, wie die übrigen Altargeräte der Stiftung, sondern von dem Münsteraner Goldschmied Lucas Boemer.
Im Ziborium bewahrt der Priester die geweihten Hostien auf, die während der Abendmahlsfeier an die Gläubigen ausgeteilt werden. Die übrig gebliebenen Hostien bleiben im Ziborium und werden in einen Tabernakel gestellt. Dort kann der Priester sie entnehmen, wenn er zu einem Sterbenden gerufen wird, um ihm die letzte Wegzehrung zu geben.