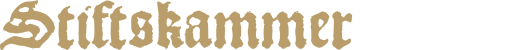Nahezu unscheinbar, direkt neben einer großen, gut bestückten Vitrine präsentiert, erblicken wir zwei kreisförmige Bronzeobjekte. Beim näheren Betrachten lassen sich zwei Löwengesichter erahnen – zugegeben: Siebenötigen ein wenig Fantasie, um diese als Löwen zu erkennen. Ihr Gesichtsausdruck mit den großen Augen und den zusammengezogenen Brauen ist beinahe schon menschlich. In ihren Mäulern tragen sie jeweils einen Ring, der mit einer Inschrift versehen ist.
Das Aussehen dieser beiden Bronzelöwen gibt uns einen wichtigen Hinweis auf ihre ursprüngliche Funktion und die Zeit, zu der sie entstanden sind. Der Ring zeigt an, dass die Löwen als Türzieher gedient haben. Sie befanden sich also an großen, schweren Türen, zumeist an Kirchen, und dienten der Öffnung. Die nahezu menschlichen Gesichtszüge der Löwen mitsamt der Gestaltung ihrer Mähne deuten auf die Romanik hin, in der sehr viele solcher Türzieher entstanden sind.
In romanischer Zeit gab es einige bedeutende Bronzegusszentren, zum Beispiel in Magdeburg, Lübeck oder Hildesheim. Nur wenige Objekte lassen sich heute noch sicher, beispielsweise über schriftliche Dokumente, diesen Orten zuschreiben. Alle anderen Türzieher versuchen Forscher über Vergleiche mit gesicherten Objekten, dem Herstellungsort zuzuordnen. Die Freckenhorster Löwenköpfe könnten demnach in Hildesheim entstanden sein.
Von anderen Türziehern dieser Zeit heben sich die Freckenhorster Löwenköpfe durch eine Besonderheit ab: Der Inschrift können wir entnehmen, dass ein gewisser Bernhardus die Löwenköpfe gegossen hat. Aus dieser Zeit sind nur wenige Künstler überhaupt namentlich überliefert, da sie ihre Werke nicht signierten. Aber wer Bernhardus war, wo er lebte und welche Arbeiten noch von ihm stammen, ist bisher leider unbekannt.